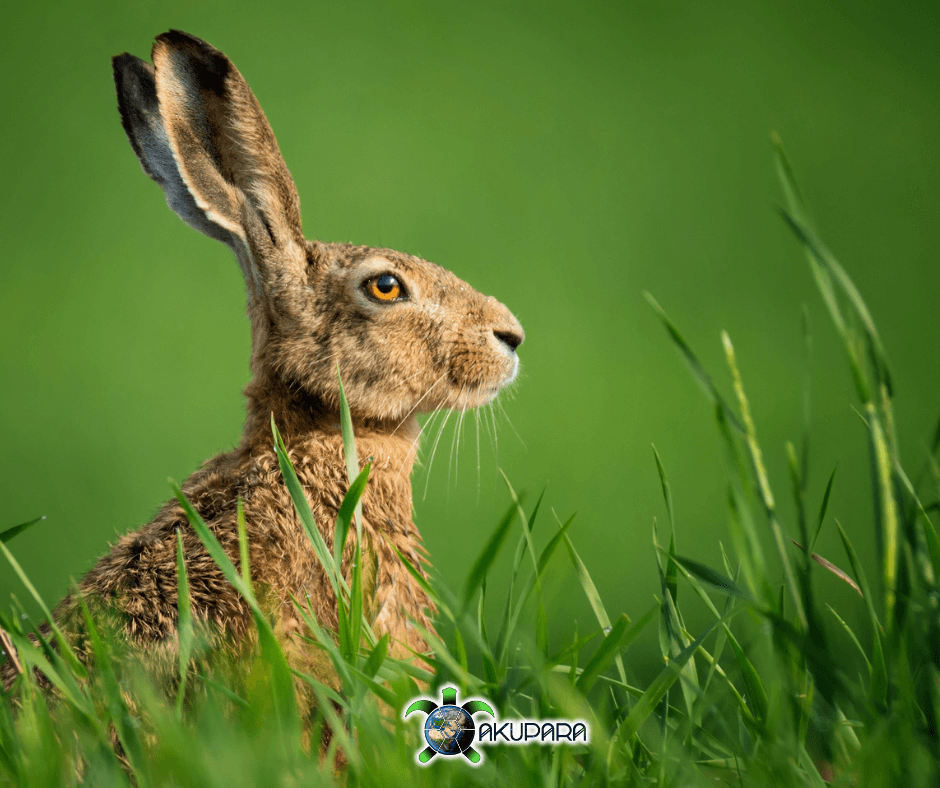Artenschützer*innen von morgen
12. Januar 2022
Wechselkröten beim Straßenseitenwechsel
23. März 2022
Jagdargumente unter der Ethik-Lupe
Text: Bettina Kliesspiess | Foto: Isabella Busch
Hitzige Debatten rund um den Wolf oder Biber lassen das Thema Jagd hochkochen. Konträre Ansichten tragen ihren Beitrag zu dem scheinbar unüberwindbaren Konflikt zwischen der Jägerschaft und Tierschützern bei. Aber nicht nur Tierschützer stellen sich auf die Barrikaden gegen die Jagd auch Stimmen aus der Wissenschaft werden laut und kritisieren Punkte der heute praktizierten Jagd. Die Jagd ist ein sehr emotional aufgeladenes Thema, da auch viele kulturelle Aspekte damit verbunden sind. Ein häufig geäußertes Argument versucht die Jagd mit den Jahrtausende alten Jagdpraktiken des Menschen rechtzufertigen. Befürworter*innen der Jagd wünschen sich einen emotionslosen und sachlichen Umgang mit dem Thema (jagdkarte.at). Auch in Bezug auf invasive Tierarten wird dieser emotionslose sachlich Umgang begrüßt – das wurde auf einer AGES-Konferenz zur Unions-Liste für invasive Tier- und Pflanzenarten im Jänner 2017 betont. Natürlich sollte wissenschaftlich fundiert, aber auch unter tierethischer Beleuchtung agiert werden. In Anbetracht des Todes eines Lebewesens seine Emotionen zu unterdrücken, ist ein recht fraglicher Zugang. Selbstverständlich wollen wir dem Thema Jagd sehr sachlich und mit wissenschaftlichen Fakten begegnen, denn viele Jäger*innen werfen den Jagdkritiker*innen Unwissenheit vor, übersehen aber oftmals, dass sich unter den Kritikern auch Wissenschaftler*innen und teilweise langjährige Ex-Jäger*innen befinden, die die heutige Jagdpraktiken nicht mehr unterstützen können z.B. Prof. Dr. Rudolf Winkelmayer.
Wir haben die gängigsten Jagdargumente herausgesucht und prüfen sie in diesem Artikel auf ihre Stichhaltigkeit, ganz ohne Emotionen, aber mit biologischen Fakten:
Individualtierschutz
Dass das Töten eines Tieres durch ein Tierschutz-Argument zu rechtfertigen ist, hört sich im ersten Moment etwas skurril an. Dabei wird die Jagd verteidigt, weil Tiere, die geschossen werden, vom tödlichen Schuss kaum etwas mitbekommen und somit einen „sanfteren“ Tod sterben. Es wird weiter argumentieret, dass der „natürliche“ Tod in freier Natur alles andere als sanft ist, denn die Tiere verhungern oder sterben an Krankheiten. Utilitarist und Environmentalist Robert Lacy drückt dieses Dilemma wie folgt aus: „The only way to end all suffering of wildlife is of eliminate the wild.” (Lacy, 1995). Hier wird auf sehr drastische (und etwas sarkastische) Art und Weise angedeutet, dass Leben (manchmal) auch mit Leid verbunden ist. Aber ist es ethisch vertretbar ein scheinbar leidendes Tier zu töten, um dem Leiden ein Ende zu setzen? Wäre hier nicht eher Hilfe geboten? Wie viel Hilfe sollte ein Mensch einem Wildtier entgegenbringen?
Bei einem genaueren Blick wird aber klar, dass das Tierschutz-Argument hinkt, denn was hier so theoretisch von „sanften Tod“ beschrieben wird, sieht in der Praxis oft anderes aus. Denn so schmerzfrei ist der Tod durch Bejagung oft doch nicht. Vor allem in der Niederwildjagd (Feldhasen und Fasane) werden Schrot-Gewehre eingesetzt, mit denen man schon 3- bis 4-mal auf ein Tier schießen muss, bis es tatsächlich dem Verletzungen erliegt (Interview Prof. Dr. Winkelmayer, 2021). Sehr viele Tiere werden nur angeschossen und schwer verletzt und verenden erst nach Stunden. Auch beschränkt sich die Jagd auch nicht auf alte und kranke Tiere, sondern eine Vielzahl der geschossenen Tiere sind kräftig und gesund, weil diese in Augen vieler Jägerinnen und Jägern „schöne“ Trophäen darstellen (Interview Prof. Dr. Winkelmayer, 2021).
Besonders spannend im Hinblick auf das Tierschutz-Argument ist auch, dass die komplette Jagd aus dem österreichischen Tierschutzgesetz ausgenommen ist und in neun unterschiedlichen Jagdgesetzen in den verschiedenen Bundesländern geregelt sind. Darin wird vor allem festgelegt, dass die Jagd „waidgerecht“ durchgeführt werden muss, die Auslegung des Begriffes „waidgerechte Jagd“ obliegt dann dem jeweiligen Jäger oder Jägerin.
Artenschutz
Die romantische Darstellung des Jägers oder der Jägerin, der/die tagein tagaus durch den Wald schleicht und die Tiere zufrieden beobachtet und wenn es, untermauert von seinem umfassenden biologischen Wissen notwendig erscheint, tötet er oder sie ein Tier, das alt und schwach ist. Dieses Vorgehen soll die Wildtierpopulation zu unterstützen und „gesund“ halten. Dieses Bild wird uns häufig durch Jäger*innen vermittelt. Was sich theoretisch wieder sehr logisch anhört, lässt in der Praxis oft zu wünschen übrig. Denn in der Jägerschaft befinden sich auch einige schwarze Schafe, oder eine ganze schwarze Schaf Herde, wie es Philosoph Univ.-Prof. Dr. Konrad Paul Liessmann formuliert. Tatsächlich werden auch viele Beutegreifer bejagt, um eine Niederwildjagd zu ermöglichen Interview (Prof. Dr. Winkelmayer, 2021). Viele Füchse, Greifvögel, Dachse, Mader und Krähen lassen jährlich ihr Leben, um die Bestände der Hasen oder Fasane für die Niederwildjagd nicht zu gefährden. Das ist ein künstlicher Eingriff in die Nahrungsnetze. Unsere Top-Prädatoren Wolf und Bär waren jahrelang in Österreich ausgestorben, weil sie im 19. Jahrhundert sehr stark bejagt wurden (WWF). Die Artenvielfalt sank also durch die Jagd. Auch in anderen Teilen der Welt ist die Jagd einer der Haupttreiber des Artenverlustes. Das Argument, Wildtiere müssen bejaget, um den Schutz der Arten zu sichern, hinkt, angesichts dieses Artenverlustes.
Naturschutz
Wildtiermanagement wird oft mit der Jagd gleichgesetzt, wobei dieses Feld weit mehr als das Töten von Tieren umfasst. Ein häufiges Argument von Jäger*innen ist, dass in einem bestimmten Habitat zu viele Tiere einer Art leben und somit ihren eigenen Lebensraum zerstören, also die sogenannte carring capacity eines Lebensraums überstiegen wird (Priscilla N. Cohn, 2013). Ob es die Jagd braucht, um die Natur im Gleichgewicht zu halten ist eine berechtigte Frage. Dabei ist interessant zu wissen, dass Populationsdynamiken bei Tierarten primär vom Nahrungsangebot abhängen (Priscilla N. Cohn, 2013, Interview Prof. Dr. Winkelmayer, 2021). Die Anzahl von Tieren kann nicht unendlich wachsen, das ist auch ein Irrglaube, den Jäger*innen manchmal verbreiten (Das habe ich (Bettina) schon selbst einmal eindrücklich erlebt: Bei einer Waldwanderung behauptete der Exkursionsleiter, der auch Jäger in diesem Gebiet ist, dass in diesem Naturabschnitt 100 Biber vorkommen. Beschäftigt man sich jedoch mit der Biologie des Bibers, so weiß man, dass Biber Reviere haben, in denen Familien von maximal 5 Tieren vorkommen. (Hölzl und Parz-Gollner, 2018)). Die Vergangenheit zeigt, dass menschliche Interventionen in der Natur oftmals schädliche Folgen haben, z.B. das Auslassen der Agar-Kröte in Australien zur Bekämpfung von Insekten in der Landwirtschaft (derStandard.at). Auch kann man sich fragen, ob die Jagd als menschliche Tätigkeit ein „natürliches“ Gleichgewicht aufrechterhalten kann. Ist das nicht eher eine Fähigkeit, die die Natur selbst besser kann? Ökologe Edward O. Wilson argumentiert in seinem Buch „Die Hälfte der Erde - Ein Planet kämpft um sein Leben“, dass man mindestens die Hälfte der Erde komplett in Ruhe lassen sollte, damit sich die Artenvielfalt und Natur erholen kann (E.O. Wilson, 2016). Auch Organisationen wie die „European Wilderness Society“ verteidigen ähnliche Ansätze, dass von Menschen unberührte Natur von hoher Qualität ist. Mit dem European Wilderness Quality Standard und Audit System werden Lebensräume zertifiziert (European Wilderness Society, 2019). Einen nahezu jagdfreien Raum gibt es bereits im Schweizer Kanton Genf, dort ist seit den 70er Jahren das Jagen verboten und nur in ganz spezifischen Fällen dürfen sogenannte staatliche Umwelthüter Wildtiere entnehmen, dabei handelt es sich um etwa 100 Tiere pro Jahr (Interview Prof. Dr. Winkelmayer, 2021). Die Flora und Fauna hat sich ohne Jagddruck erheblich verbessert. Das Naturschutzargument ist laut Prof. Dr. Winkelmayer ein gekonntes Greenwashing der Jägerschaft.
Invasive Arten
Die Fähigkeit und Lust am Verändern von Ökosystemen sind uns Menschen angeboren. Das ist per se nichts Schlechtes, auch andere Tierarten sind sogenannte ökologische Ingenieure, wie beispielsweise der Biber, Eichhörnchen oder Elefant. Die Tätigkeiten dieser Tierarten sind im Gegensatz zu den meisten menschlichen Veränderungen förderlich für den Artenschutz. An allen Ecken und Enden hat der Mensch Einfluss auf die Artzusammensetzung in verschiedensten Lebensräumen. Der Fasan beispielsweise kommt ursprünglich aus dem asiatischen Raum und wurde vermutlich von den Römern für Jagdzwecke nach Europa gebracht. Auch der Waschbär stammt ursprünglich aus Nordamerika und wird als invasive Tierart klassifiziert. Seit 2015 ist die Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 über die Prävention und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten in Kraft, diese beinhaltet die Unionsliste der invasiven Arten, wo alle invasiven Tier- und Pflanzenarten auflistet sind, die einen negativen Effekt auf das menschliche Leben oder andere Tier- und Pflanzenarten haben (neobiota-austria.at). Es liegen Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Tiere vor. Die Jagd spielt dabei eine große Rolle – nicht-letale Methoden sind zudem sehr selten im Einsatz und kaum erforscht (Priscilla N. Cohn, 2013).
Der Konflikt mit invasiven Tierarten ist jedoch gar nicht so einfach zu bewältigen, oftmals steigt die Anzahl der Nachkommen durch die Bejagung noch an, diesen Effekt nennt man compensatory reproduction (kompensatorische Reproduktion) (Priscilla N. Cohn, 2013). In vielen Fällen kann man feststellen, dass eine invasive Tierart durch jahrzehntelange Jagd noch nicht ausgerottet wurde, was oftmals das Ziel ist (z.B. Ratte oder Marder in Neuseeland). In solchen Fällen muss man sich fragen, ob die Jagd ein zielführendes Mittel ist oder ob es nicht gelindere Mittel gibt, wie beispielsweise der Einsatz von Verhütungsmittel oder man arrangiert sich mit der neuen Artzusammensetzung und versucht in Zukunft solche Missgeschicke und Eingriffe in die Natur zu vermeiden. In einigen Fällen bringen Neobiota auch Vorteile in das neubesiedelte Ökosystem, was aber nicht als Einladung zum erneuten Aussetzen von Tierarten verstanden werden darf. Sehr interessanter Buchtipp für dieses Thema ist „Die neuen Wilden“ von Fred Pearce.
Gefahr für Menschen
Wildtierbegegnungen können mitunter Gefahren für den Menschen darstellen, wie beispielsweise Krankheitsübertragung, Kollisionen mit Fahrzeugen oder auch Angriffe. Was vor tausenden Jahren in Zeiten von Beutegreifern dicht besiedelten Wäldern eine durchaus berechtigte Angst war, ist heute nur noch mit einem verschwindend kleinen Risiko verbunden. Der Angriff durch Wildtiere. Oftmals sind Angriffe von Wildtieren auf Menschen nicht durch Nahrungsbedürfnisse ausgelöst, sondern weil sie sich bedrängt fühlen oder ihre Jungtiere beschützen wollen. Dieselbe Gefahr geht übrigens auch von Weiderindern aus, wenn man diese bedrängt oder ihren Jungtieren zu nahekommt, können sich auch Angriffe auf Menschen ereignen. Der Gefahr eines Angriffes ist also sehr einfach zu umgehen, wenn man sich an gewisse Regeln hält und die Tiere in ihrem Lebensraum genügend Raum lässt. Angeschossene Tiere stellen überdies noch einen zusätzlichen Risikofaktor da, den diese können aus berechtigten Gründen auch aggressiv gegenüber Menschen reagieren. Weitaus gefährlicher sind Krankheiten, die von Wildtieren übertragen werden, ein Grund mehr die Jagd auf Wildtiere zu unterlassen.
Fleisch
Führt man sich das Leid in der Massentierhaltung vor Augen so ist das Fleisch eines Wildtieres, das in Freiheit aufgewachsen ist und keinen tierquälerischen Haltungsbedingungen ausgesetzt war, wesentlich tierfreundlicher als ein aus der konventionellen Massentierhaltung stammendes Schnitzel. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass bei der Jagd ein Tier getötet wird, das einen berechtigten Willen hat, sein Leben fortzusetzen. Aus tierrechtlicher Perspektive, die jedem Tier ein Recht auf Leben zugesteht, ist es dennoch nicht moralisch vertretbar ein Tier für Fleisch zu jagen. Aus Tierwohlperspektive stellt Fleisch von Wildtieren sicherlich eine Alternative zu Fleisch aus der Massentierhaltung dar. Vergegenwärtigt man sich jedoch die Verhältnisse der heute auf der Erde lebenden Säugetiere - 90% aller Säugetiere leben, um geschlachtet zu werden (quarks.de), so wird schnell klar, dass wir aber dennoch den weltweiten Fleischkonsum überdenken müssen, dieser kann nämlich keinesfalls mit Wildfleisch gedeckt werden. Auch darf man nicht vergessen, dass die vermeintliche Freiheit von Wildtieren vielfach keine tatsächliche Freiheit ist. Sehr viele Wildtiere werden in Wildgattern gehalten und dann für Jagdzwecke freigelassen (martinballuch.com). Fasane werden beispielsweise ähnlich der Massentierhaltung in Fasanerien gezüchtet, um dann die an Menschen gewöhnten Tiere in die Wildnis entlassen, um sie für Jagd zu nutzen (martinballuch.com).
Hegemaßnahmen
Jäger*innen haben aber neben der klassischen Jagd auch weitere Aufgaben, die unter den Begriff Hegemaßnahmen zusammengefasst werden, darunter fallen beispielsweise das Aufsuchen von Rehkitzen (jagdkarte.at), das Nachsuchen mit Hunden von angeschossenen Tieren, aber auch das Zufüttern im Winter. Das Argument das Jäger*innen auf das Wohl der Tiere achten, was auch bestimmt in vielen Bereichen richtig ist, lässt in der Praxis aber doch zu wünschen übrig. Denn Hegemaßnahmen führen erst dazu, dass in einem Lebensraum mehr Tiere leben können, als die natürlichen Ressourcen in diesem Gebiet eigentlich hergeben (siehe Argument Naturschutz). Das bedeutet Jäger*inne tragen dazu bei, dass in einem Gebiet „zu viele Tiere“ vorkommen, die sie dann erlegen „müssen“. Obwohl es sehr wichtige Hegemaßnahmen gibt, die zum Wohl der Tiere und zum Artenschutz beitragen, wie das Aufsuchen von Rehkitzen auf Feldern vorm Dreschen, hinkt das Hege-Argument, wenn dadurch sehr dichte Tierpopulation aufrechterhalten werden. Diese widersprechen sich nämlich auch mit dem Naturschutzargument für die Jagd.
Menschliches Kulturgut
„Die Jagd liegt dem Menschen im Blut“, lautet ein häufiges Argument, denn der Mensch jagt seit Beginn seiner Zeit. Der Jagd bekommt dadurch einen „natürlichen“ Anstrich, etwas das dem Menschen in die Wiege gelegt wurde. Selbstverständlich sind Traditionen und Rituale für Menschen wichtig und oftmals etwas Schönes, das einem Halt im Leben geben kann. Jedoch sollten Traditionen und Rituale immer wieder überdacht werden und niemals mit dem Argument „Wir machen das so, weil es immer schon so gemacht wurde“ gerechtfertigt werden. Das Töten von Tieren ist in den allermeisten Fällen nicht mehr notwendig, um unser Leben zu sichern, deshalb sollten wir die Jagd als Kulturgut überdenken. Denn viele andere Praktiken „die schon immer so gemacht wurden“ sind auch moralisch nicht zu vertreten, wie etwa Krieg oder die Unterdrückung von Frauen in den weltweit verbreiteten patriarchalen Strukturen. Lass uns also gemeinsam neue Rituale oder Traditionen einführen, die dem 21. Jahrhundert mehr gerecht werden – wie wäre es mit dem Veggy-Donnerstag?
Die Jagd ist ein Beruf
In Österreich gibt es 130.000 Jägerinnen und Jäger, davon sind 110.000 Hobbyjäger*innen und 20.000 Jagdschutzorgane, also Berufsjäger*innen (Interview Prof. Dr. Winkelmayer, 2021). Die Existenz dieser Menschen muss natürlich auch gesichert werden. In Anbetracht des Artensterbens und der Klimakrise braucht es auch viele Menschen, die sich für die Natur einsetzen und auch schon viel Erfahrung gesammelt haben. Das Jagen von Tieren kann aus dem Fokus genommen werden und andere Managementmaßnahmen und Dokumentationsaufgaben können mehr forciert werden, also ein Berufswandel von Jäger*innen zu Umweltmanager*innen. Prof. Dr. Winkelmayer argumentiert, dass wir die sogenannte Ultima-Ratio-Jagd in unserer Kulturlandschaft nach wie vor brauchen. Prof. Dr. Winkelmayer erklärt, dass in seltenen Fällen Individuen bestimmter Tierarten (wie Wildschwein) geschossen werden müssen, da sie sich zwischen unseren Mais- und Getreidefeldern sehr schnell vermehren können. Aus tierrechtlicher Perspektive ist diese Art der Jagd moralisch nicht vertretbar, aus utilitaristischer Sicht kann dieses Argument moralisch vertretbar sein. Die Hobbyjagd als solches wäre aber unter allen Umständen unter tierethischer Perspektive anzulehnen.
Jagd zum Freizeitvergnügen
Sind alle Argumente betreffend den Tierschutz, Artenschutz und Naturschutz entkräftet, dann bleibt ein anthropozentrisches Argument stehen, und zwar, dass die Jagd Spaß macht und als Freizeitvergnügen ausgeführt wird. Die Lust am Töten ist natürlich in der Gesellschaft nicht so gerne gesehen und wird deshalb oft von den oben angeführten Argumenten verschleiert. Aber hinter der Jagd steht eine riesige Industrie und Lobby, bei der es um viel Geld geht – Stichwort Canned Hunting (oder zu Deutsch: Gatterjagd), also das Jagen von in Gehegen gezüchteten Trophäentieren. Es werden viele Reisen in verschiedene Länder wie Südafrika oder USA (v.a. Texas) angeboten, wo Jäger*innen gezüchtete Tiere schießen können. Oftmals wird mit 100%er Abschussgarantie geworben, das bedeutet, dass die Tiere oft noch halb-sediert von Menschen gejagt werden, um auch tatsächlich erlegt werden zu können. Wie viel „Waidgerechtigkeit“ diese Praxis noch in sich trägt sei dahingestellt. Das Jagen zum menschlichen Vergnügen ist aber aus allen tierethischen Perspektiven strikt abzulehnen.
Fazit: Es gibt viele Menschen, die sich der Jagd verschrieben haben. Alle praktizieren die Jagd aus unterschiedlichsten Gründen, die einen sind leichter moralisch zu rechtfertigen als andere. Bei aller Emotionalität, die oftmals bei Diskussionen zwischen Jäger*innen und Jagdkritiker*innen hochkocht, sollte jedoch der Respekt nicht verloren gehen – auch nicht gegenüber den Tieren.
Quellen:
- jagdkarte.at
- Robert Lacy (1995) Culling surplus animals for population management, in: Ethics on the Ark von Bryan G. Norton, Michael Hutchins, Elizabeth F. Stevens und Terry L. Maple.
- Interview Prof. Dr. Rudolf Winkelmayer 2021
- Interview Konrad Paul Liessmann im Magazin JAGD HEUTE
- WWF Österreich
- Priscilla N. Cohn (2013) The ethics of killing free-living animals, in: The global guide to animal protection von Andrew Linzey
- Hölzl und Parz-Gollner (2018) Die Biber-Praxisfibel- Maßnahmen zur Konfliktlösung im Umgang mit dem Biber Castor fiber
- E.O. Wilson (2016) Die Hälfte der Erde - Ein Planet kämpft um sein Leben
- European Wilderness Society, 2019
- Wilderness Definition - European Wilderness Society
- Der Standard
- Unionsliste 2015
- Fred Pearce (2016) Die neuen Wilden - Wie es mit fremden Tieren und Pflanzen gelingt, die Natur zu retten
- Quarks.de
- Martinballuch.com
Was denkst du darüber?